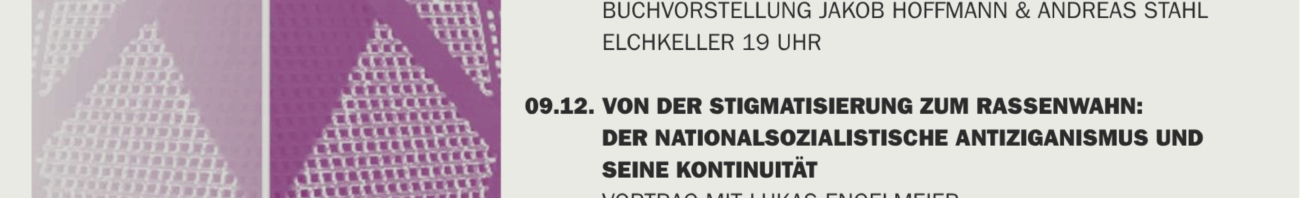Veranstaltungsreihe gegen das Vergessen und für eine antifaschistische Geschichtspolitik
Die Veranstaltungsreihe ist dem Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus gewidmet. Sie nicht zu vergessen, begreifen wir als zentrale Aufgabe eines emanzipatorischen Antifaschismus.
Am 27. Januar 1945 befreite die Rote Armee das Vernichtungs- und Konzentrationslager Auschwitz. Bis heute steht Auschwitz exemplarisch für die nationalsozialistische Politik der Verfolgung, Entrechtung, Entmenschlichung und systematischen Ermordung von Millionen Menschen. Wie der 9. November (Pogromnacht 1938) wurde auch der Tag der Befreiung von Auschwitz zum Symbol institutioneller Bemühungen die Erinnerung an die nationalsozialistischen Verbrechen wachzuhalten.
STAAT & GEDENKEN
Antifaschistisches Gedenken an den Nationalsozialismus braucht jedoch mehr als isolierte Gedenktage und ritualisierte Zeremonien. Es braucht mehr als eine offizielle Geschichtspolitik, die jahrelang zur Selbstentlastung der Täter:innen beitrug. Immer wieder Stück für Stück wurde sich so die Vergangenheit auf eine Weise angeeignet, die es Deutschland ermöglichte, erneut einen versöhnlichen Bezug zum eigenen Nationalgefühl herzustellen.
Die Forderungen Überlebender und Angehöriger nach Entschädigungszahlungen oder einer ernst zu nehmenden gesellschaftlichen sowie juristischen Aufklärung der Verbrechen blieben viel zu oft unerhört. Selbst die Anerkennung aller Opfergruppen ist bis heute nicht abgeschlossen.
RELATIVIERUNG
Auch 80 Jahre nach der bedingungslosen Kapitulation Nazideutschlands wird das Gedenken an nationalsozialistische Verbrechen immer wiederunübersehbar angegriffen. Während Nazis auf der Straße Gedenkstättenmitarbeiter*innen attackieren, sehnt sich die AfD in den Parlamenten nach einer „erinnerungspolitischen Wende um 180 Grad“ und bemüht sich in Zusammenarbeit mit konservativen Kräften um die Verschiebung des Opferdiskurses. Ausdruck dieser Verschiebung sind etwa die Verharmlosung der Wehrmachtsverbrechen oder die Gleichsetzung deutscher Kriegsopfer mit den von Nazideutschland verfolgten Menschen. Erzählungen, die gesellschaftsfähig sind und realpolitische Auswirkung auf die Finanzierung von geschichtspolitischen Projekten haben.
Wir treten solchen und anderen Relativierungen entschlossen entgegen. Wir streiten für ein emanzipatorisches und antifaschistisches Geschichtsverständis auf Grundlage einer konsequenten Analyse gesellschaftlicher Verhältnisse.
Und unser Standpunkt widerspricht klar der Verharmlosung deutscher Schuld und Verantwortung. „Nie wieder“ ist keine Phrase sondern eine Überzeugung die wir auch inhaltlich begründen müssen.
Für uns bedeutet das auch einer Geschichts- und Gedenkpolitik zu widersprechen, die die Shoah enthistorisiert, beliebig gleichsetzt und relativierend instrumentalisiert. Das Gedenksteine mit „Fuck Israel“ beschmiert werden, sich rechte Schlussstrichforderungen schamlos in „FreePalestine from German Guilt“ übersetzen lassen und Antisemitismus zum Kampfbegriff erklärt wird, darf nicht als Ausdruck politischer Diskussion – auch in linken Zusammenhängen – verklärt werden.
NOTWENDIGKEIT
Solange antifaschistische Erinnerungsarbeit infrage gestellt und Geschichtsrevisionismus akzeptiert wird, ist nichts von der Bedeutung einer gesellschaftskritischen Analyse des Nationalsozialismus überflüssig. In einer Zeit antisemitischer Angriffe, rassistischer Abschiebepolitik und sozialdarwinistischer Hetze wollen wir uns gegen Gleichgültigkeit, Unwissen und für mehr kritische Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus, dem Faschismus und der Shoah, Porajmos und „Euthanasie“-Verbrechen einsetzen.
EMANZIPATION & KRITIK
Unsere Veranstaltungsreihe macht es sich zur Aufgabe, NS-Verfolgte und ihre Erfahrungen nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Sie will Wissen über theoretische Auseinandersetzungen mit der NS-Ideologie vermitteln. Und sie will die Täter:innen benennen.
Für uns heißt das auch an einer theoretischen Weiterentwicklung radikaler Gesellschaftskritik festzuhalten, die sich nicht auf reine Identitätspolitik zurückzieht. Eine Gesellschaftskritik, die statt der »Entideologisierung« das Unbehagen aufrechterhält, dass die Nachkommen der Täter:innen beschleichen sollte, wenn sie einmal wieder über das Fotoalbum ihrer Großeltern stolpern. Eine Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus muss die gesellschaftlichen Wurzeln von Ideologie in den Blick nehmen.
Unser Plädoyer gilt dem Nicht-Mitmachen, dem Widersprechen, dem Nein-Sagen. Wir verstehen die aktuellen Verhältnisse nicht als etwas „Naturgegebenes“ und weigern uns eine
vermeintliche Unveränderbarkeit der Welt hinzunehmen.
Vielmehr wollen wir gemeinsam über Veränderungen und Leerstellen antifaschistischer Geschichtspolitik diskutieren. Wir wollen überlegen, wie eine antifaschistische Praxis des Gedenkens aussehen kann und welche Rolle dabei Erziehung und Bildung spielt. Und uns fragen, ob wir überhaupt über die Idee einer befreiten, klassenlosen Gesellschaft sprechen können, ohne auf den Nationalsozialismus und seine Ideologie auch in “entnazifizierten” Formen zu reflektieren.
Dazu laden wir euch herzlichst ein.
Gemeinsam gegen das Vergessen und für eine antifaschistische Geschichtspolitik.
November
13.11. Kritik des Nationalsozialismus & Emanzipation
Podiumsgespräch, Sturmglocke 18 Uhr
16.11. Hannover im Nationalsozialismus
Stadtrundgang, Treffpunkt MarktHalle 13 Uhr
22.11. Behemoth. Eine Einführung in Franz
23.11. Neumanns Analyse des nationalsozialistischen Unstaats
Wochenendseminar Mit Moritz Zeiler
Anmeldung unter SJ-biref@falken-hannover.de
Dezemeber
03.12. Erinnern Als Höchste Form des Vergessens? (Um)-Deutungen des Holocausts
und der “Historikerstreit 2.0”
Buchvorstellung Jakob Hoffmann & Andreas Stahl
Elchkeller 19 Uhr
09.12. Von der Stigmatisierung zum Rassenwahn: Der nationalsozialistische Antiziganismus
und seine Kontinuität
Lukas Engelmeier, Kompetenzstelle gegen Antiziganismus
UJZ Kornstraße 19 Uhr
17.12. Liza ruft! | !ליזאַ רופט
Filmvorführung & Ggespräch mit Christian Carlsen
Kino am Raschplatz 18 Uhr
Januar
14.1. “Alles Opfer?” – Vertriebenenverbände und Geschichtspolitik
Vortrag mit Lars Breuer, ujz Kornstraße 20 Uhr
21.1. Die Frauen und die Schulen von Reggio Emilia
Multimedia Lesung mit Sabine Lingenauber &
Janina V. Niebelschütz Libresso Libertär 19 Uhr
27.1. Antifaschistische Kundgebung
tba
Februar
25.2. Sexuelle Zwangsarbeit im Lagerbordell am Beispiel von Franziska W.
Vortrag mit Randi Becker, 14.OG Conti hochhaus 19 uhr